Indian man (2), Mauritius, October 4, 1975 : But when these fellows have come there…
Prabhupada: These fellows… Therefore your authority are these fellows. (laughter) These fellows will say something now, and after ten years they will change. These fellows are like that. (laughter)
Indian man (3): According to science it is said that…
Prabhupada: “According to science” means American science or Russian science. That’s all.
Indian man (2): The sun, you see, is a ball of fire. Nothing can exist there, according to…
Prabhupada: No. We have got information—even in the fire there are living entities. Why? Because, in the Bhagavad-gita you will find. The constitutional position of the living entity is that it does not become burned. So how you can say that in the fire? What is the verse? No, no. In the second chapter there is the description of the living entity, you find. The living entity… Find out.
Harikesa: Acchedyo?
Prabhupada: Acchedyo ’yam adahyo ’yam. Find it.
200 Jahre Darwin
Die mikroskopischen Spiele der Evolution
Von Jörg Hacker, FAZ
Staphylococcus-aureus-Bakterien im Kampf mit weißen Blutkörperchen.
14. Februar 2009 Als Charles Darwin im Oktober 1836 von seiner Weltreise mit der “Beagle” nach England zurückkehrte, sichtete er seine Materialien und ließ sich viel Zeit mit der Veröffentlichung der Früchte seiner Exkursion. Erst 1859, vor nunmehr 150 Jahren, publizierte Darwin seine Erkenntnisse in der Schrift “On the Origins of Species by means of Natural Selection”.
In diesem Werk formulierte er seiner Evolutionstheorie, die in die berühmte “Trias” mündete: Erstens, so Darwin, sei Voraussetzung für die Entwicklung des Lebens die Entstehung von Vielfalt. Zweitens unterlägen die Produkte dieser Variabilität – die Arten und Varianten – dem Selektionsprozess, der natürlichen Zuchtwahl. Und drittens sei das Maß des “Erfolges” der Evolution die Vermehrungs- und Ausbreitungsfähigkeit der neuen Organismen.
Was Darwin nicht wissen konnte
Darwin formulierte seine Evolutionslehre auf der Basis von Beobachtungen, vor allem auf dem Gebiet der vergleichenden Anatomie. Diese Forschungsrichtung befand sich in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Was Darwin nicht wissen konnte: Die Entwicklung des Lebens war vor allem durch eine beispiellose Variabilität der Erbsubstanz, der Gene, bedingt. Gregor Mendel veröffentlichte erst sieben Jahre nach Erscheinen von Darwins Werk die nach ihm benannten Vererbungsgesetze und es dauerte noch einmal mehr als dreißig Jahre, bis diese in der Fachwelt anerkannt waren.
Viele der heute bekannten Phänomene der Evolutionslehre sind durch Beobachtungen und Experimente an Bakterien und Viren gewonnen worden. Diese kleinsten Lebewesen unseres Erdballes waren zu Darwins Zeiten nur in Ansätzen oder gar nicht bekannt. Robert Koch klärte erst siebzehn Jahre nach Erscheinen von Darwins Buch den Zusammenhang zwischen Bakterien und Infektionen auf. Die ersten Viren wurden erst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts beschrieben. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass Darwin schon Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auf der Grundlage des ihm zugänglichen Wissens eine so weit reichende und in ihren Grundzügen plausible Lehre von der Entwicklung des Lebens formulierte.
Darwin und die Genomik
Was haben die beiden von Darwin nicht oder kaum beachteten Wissenschaftsdisziplinen, die Vererbungslehre und die Mikrobiologie nun zur Weiterentwicklung der Evolutionslehre beigetragen, was tragen sie heute bei? Seit der Entschlüsselung der gesamten Erbsubstanz eines Lebewesens vor vierzehn Jahren ist eine Verschmelzung dieser beiden Disziplinen zur Genomforschung oder “Genomik” zu beobachten. Es ist inzwischen möglich, Genome ganzer Lebewesen miteinander zu vergleichen, sie zu analysieren und zu fragen, ob Spuren der Evolutionsprozesse in ihnen sichtbar sind.
Lässt sich Darwin in den Sequenzen der Genome wieder finden? Ich denke ja, zunächst einmal bei den einzelligen Bakterien. Im Gegensatz zu den Genomen höherer, zellkernhaltiger Organismen, den Eukaryonten, sind die von Bakterien relativ simpel aufgebaut. Aus der Genomanalytik wissen wir, dass die bakterielle Erbsubstanz aus einem relativ konstanten Teil und einem flexiblen Bereich besteht. Letzterer, der etwa bei Darmbakterien dreißig Prozent des gesamten Erbgutes ausmacht, kann durch die Übertragung mobiler genetischer Elemente, beispielsweise von Genominseln, Plasmiden oder Bakteriophagen erworben werden.
Mechanismen zum Gentransfer
Gentransfer bewerkstelligen die Bakterien sogar “horizontal”, über Artgrenzen hinweg und sie haben trickreiche Mechanismen ausgebildet, mit deren Hilfe sie ihre Gene untereinander austauschen und so eine ungeahnte genetische Vielfalt hervorbringen, die wiederum die Grundlage der Selektion und Verbreitung darstellt. Gerade Bakterien, die erfolgreich bestimmte Lebensräume, wie die Tiefsee, den Wüstenboden oder heiße Quellen besiedeln, tragen transferierte Genbereiche.
Besonders gut lassen sich der horizontale Gentransfer und die durch ihn ausgelösten Prozesse aber bei Krankheitserregern nachvollziehen. Es werden ständig neue Varianten pathogener Mikroorganismen generiert, die Infektionen beim Menschen, vielen Tieren und Pflanzen auslösen. Die Evolution vollzieht sich hier mit atemberaubender Geschwindigkeit in Wochen oder gar Tagen quasi als “Evolution unter dem Mikroskop”.
Vergrößerte und verkleinerte Genome
So entstehen immer neue Bakterien, die Resistenzen gegen die gängigen Antibiotika aufweisen. Gentransfer ist meist die Ursache bei der Bildung von multiresistenten Eitererregern oder Auslösern von Blutvergiftungen. Zudem pumpen die Erreger von Lungenentzündungen, Pseudomonaden genannte Bakterien, ihr Genom durch die Inkorporation zusätzlicher mobiler genetischer Elemente auf, so dass sie gefährliche Krankheitsfaktoren wie Gifte oder Schleimsubstanzen produzieren, die dann die menschlichen Lungenzellen schädigen oder zerstören. Hier gilt der Grundsatz, je größer je besser.
Aber auch der gegenläufige Effekt wird beobachtet: Erst seit kurzem wissen wir, dass auch Genverluste, wir sprechen von “black holes” im Erbmaterial, eine immense Bedeutung für die Evolution haben können. Gerade Bakterien, die sich eng an bestimmte Wirte angepasst haben, werfen Teile ihrer Genome ab, die daraus resultierenden kleinen Genome verleihen ihren dann die Möglichkeit, sich schnell zu vermehren, wobei sie die benötigten Nahrungsmittel sowie die Energie von ihren Wirten bekommen. Der Erreger des Fleckfiebers und der Pesterreger haben verkleinerte Genome, verglichen mit ihren weniger gefährlichen nächsten Verwandten. Sein kleines Genom verleiht dem Pestbazillus eine größtmögliche Anpassung an den Überträger der Infektion, den Pestfloh.
Mit Mutationen zur Resistenz
Auch Austausch, Verlust oder Erwerb von einzelnen Bausteinen der Erbsubstanz wird beobachtet. Bestimmte Bakterienvarianten weisen sogar eine unvergleichlich hohe Rate an solchen lokalen Genveränderungen oder Mutationen auf. Diese werden als “Mutatorstämme” bezeichnet und passen sich besonders gut an bestimmte Milieus an. Den schon erwähnten Pseudomonaden gelingt es so, sich schnell in der Lunge und den Bronchien festzusetzen.
Aber auch bei Aids-Viren sind mittlerweile Mutationen zu beobachten, die zu erhöhter Arzneimittelresistenz und zu größerem Krankheitspotential führen. Neben der Übertragung und dem Verlust von großen Genbereichen und den Mutationen existiert ein vierter Mechanismus, der das Genom von Mikroben in ständiger Bewegung hält, es sind dies die Umlagerungen oder “Genrearrangements”. Diese Prozesse sind oftmals durch das Wirken von “springenden Genen” oder Transposons bedingt, die ständig neue Varianten hervorbringen können. Die Oberflächenstrukturen von Bakterien, die Blasen- und Nierenentzündungen hervorrufen, werden etwa durch solche Genumlagerungen laufend verändert, was ihnen zusätzliches Krankheitspotential verleiht. Auch bei der Bildung von neuen Varianten der Influenza-Viren sind Genrearrangements die Ursache für die infektiöse Wirkung.
Die Reihe der durch genetische Vielfalt entstandenen und gerade entstehenden Krankheitserreger ließe sich beliebig fortsetzen – die Evolution entlässt ihre Kinder in Form von pathogenen Mikroben. Und zwar kontinuierlich mit großer Geschwindigkeit und hoher Erfolgsrate. Letztere ist nicht zuletzt an der durchaus beunruhigenden Seuchenstatistik der Weltgesundheitsorganisation ablesbar.
Genomvariation durch Sex
Mikroben gibt es seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Die zellkernhaltigen Eukaryonten dagegen sind Newcomer der Evolution, manche Vielzeller unter ihnen existieren erst seit einigen hundert Millionen Jahren oder sind, wie der Mensch, noch viel jünger. Vielleicht als eine Art Antwort auf die erfolgreiche Entwicklung der Mikroben haben auch die kernhaltigen Organismen die Prozesse der Genomvariation übernommen – erwiesen diese sich doch offensichtlich bei den Mikroben als ein gutes “Geschäftsmodell der Evolution”.
Letztlich muss man die sexuelle Vermehrung, die eine immer neue Variantenvielfalt im Zellkern hervorruft, in diesem Sinne interpretieren. Aber Eukaryonten tragen neben dem Zellkern noch weiteres Erbmaterial in ihren Zellen, etwa die Mitochondrien oder die Chloroplasten. Durch Genomanalysen wissen wir heute, dass diese Elemente auf bakterielle Genome zurückgehen, die im Zuge der Evolution in die höheren Organismen eingebaut wurden – buchstäblich ein Genomklau.
Wettlauf der Mutationen
Charles Darwin veröffentlichte nach seiner Beagle-Reise nun aber nicht nur seine unvergleichlichen Naturbeobachtungen, auch die Menschen ferner Kontinente hat er studiert und beschrieben. In Australien, das er im Januar 1836 besuchte, war ihm aufgefallen, dass viele Menschen an Infektionen wie an Masern litten, gegen die kein Kraut gewachsen war. Was Darwin damals nicht wissen konnte: Auch die Abwehrmechanismen höherer Lebewesen gegen infektiöse Mikroben sind letztlich auch auf Prozesse der Genomvariabilität zurückzuführen. Für die Aids-Krankheit ist bekannt, dass ein bestimmtes menschliches Eiweiß normalerweise für das Eindringen der Viren in Wirtszellen notwendig ist. Eine Mutation in dem Gen kann den Infektionsprozess jedoch stoppen, führt also zur Infektionsresistenz.
Vor allem sind es aber die sehr effektiven Prozesse der erworbenen Immunität, denen ein hoher Grad an Genomflexibilität, bedingt durch Genrearrangements, zu Grunde liegt. In den Immunzellen werden Bestandteile des Erbgutes getrennt und dann wieder zusammengefügt, mit der Konsequenz, dass Antikörper oder Abwehrzellen passgenau gegen Erreger gebildet werden. Diese Mechanismen ähneln dem Umbau der Mikrobengenome. Gerade jüngst hat die Analyse dieser Prozesse enorme Fortschritte gemacht. Und in der Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Genomforschung weitere Erkenntnisse zutage fördern wird und so die Spiegelung der Evolution im Erbmaterial bestätigt. Insofern sind wir nicht nur im “Darwin-Jahr”, nein, wir sind schon mittendrin in dem Jahrhundert, das ein “Darwin-Jahrhundert” zu werden verspricht.
Jörg Hacker ist Mikrobiologe und Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin.
Text: F.A.Z.
Bildmaterial: Rocky Mountain Laboratories, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

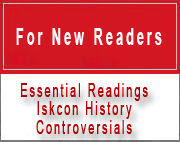
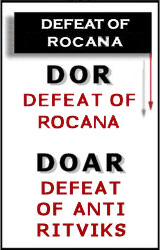
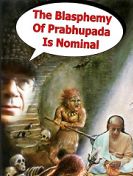
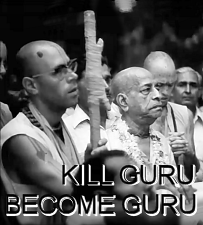
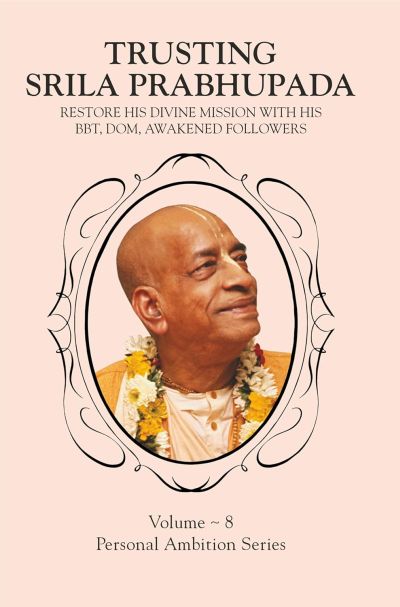
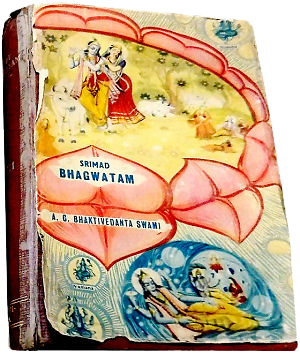
Speak Your Mind